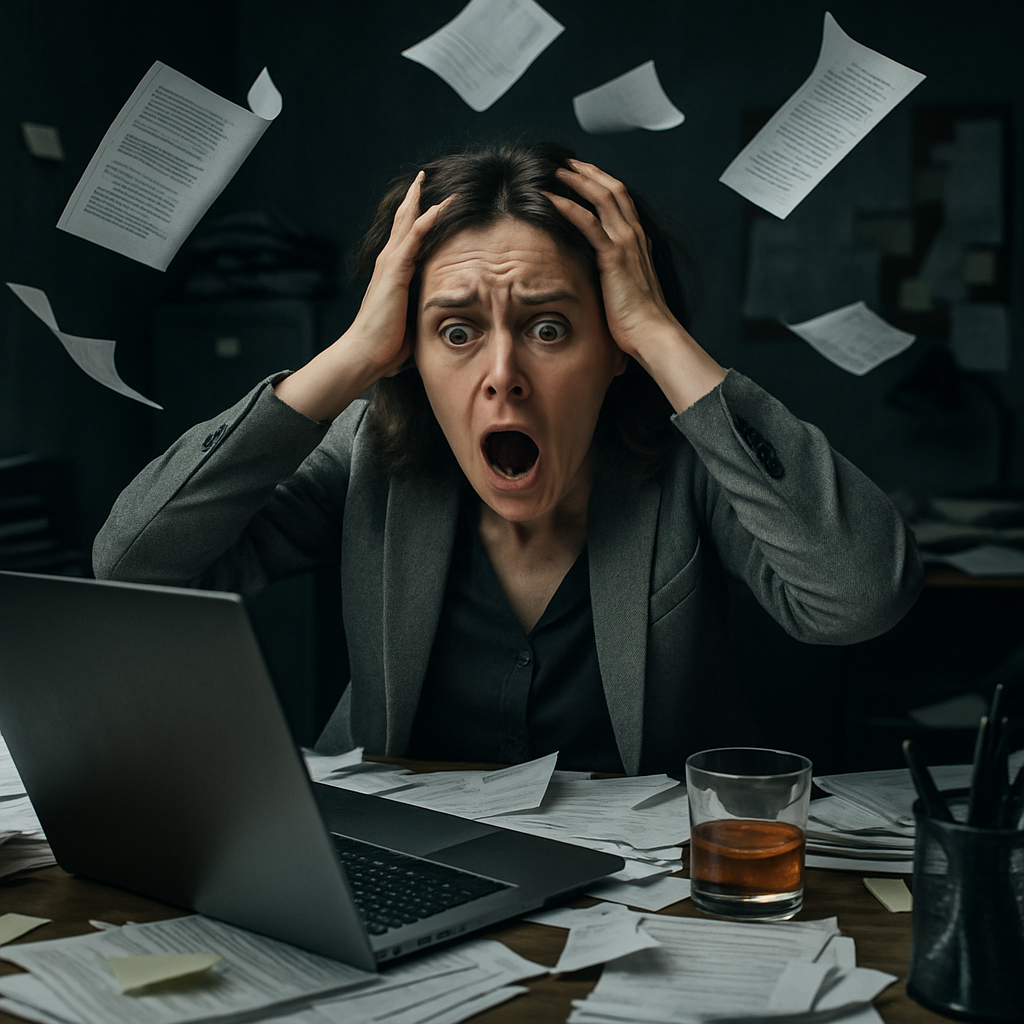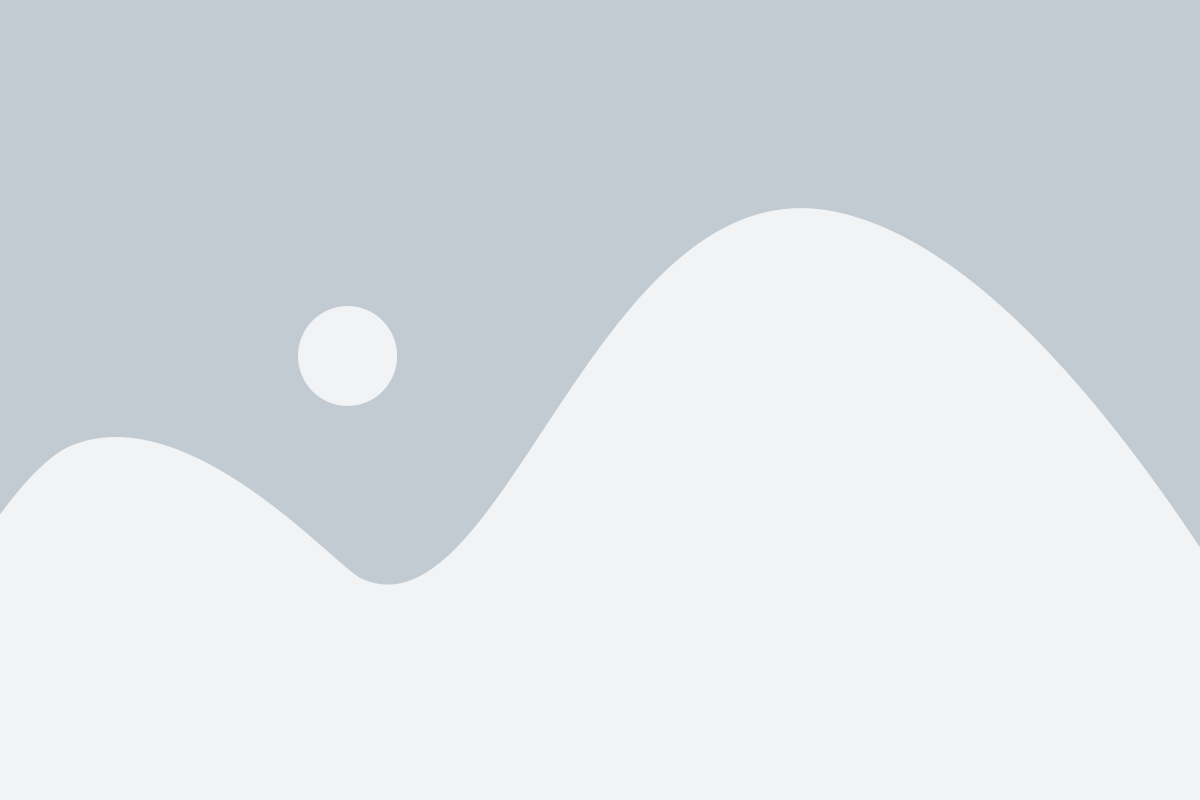Produktpiraterie im Überblick

Produktpiraterie ist die unerlaubte Herstellung und der Vertrieb von Waren, die geistiges Eigentum verletzen, oft unter Missbrauch von Marken, Designs oder Patenten. Das Phänomen hat sich zu einer ernsten Bedrohung für Marken entwickelt, mit Schäden, die sich jährlich auf Milliarden Euro belaufen.
In diesem Blog skizzieren wir die Dimension von Produktpiraterie, schauen auf die Masche mit Fake-Accounts auf sozialen Medien und zeigen Warnsignale.
Die erschreckenden Dimensionen der Produktpiraterie
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Europäische Hersteller verlieren durch Produktpiraterie jährlich 60 Milliarden Euro an Einnahmen. Gleichzeitig entgehen den EU-Staaten dadurch Steuern und Sozialabgaben von 16,3 Milliarden Euro pro Jahr. Noch dramatischer sind die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Fälschungen vernichten in der gesamten EU direkt knapp 470.000 Arbeitsplätze, davon allein in Deutschland mehr als 64.100, wie die IHK München in dieser Übersicht skizziert hat.
Der Schaden für die deutsche Industrie wird auf rund 50 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Dabei werden 79 Prozent der Unternehmen mehrmals im Jahr Opfer von Produktfälschungen. Im deutschen Maschinen- und Anlagenbau gaben 2024 bereits 46 Prozent der Mitgliedsunternehmen an, unter Produkt- und Markenpiraterie zu leiden.
Schauen wir auf die österreichischen Kollegen, können wir deutliche Zuwächse in den Beschlagnahmungen des Zolls feststellen: Im Jahr 2023 wurden insgesamt 194.165 Artikel beschlagnahmt, was einem Zuwachs zum Vorjahr (2022) von 586 % entspricht. Expertinnen und Experten macht hier besonders der anteilsmäßig starke Zuwachs von Medikamenten Sorgen, die ernsthafte gesundheitliche Folgen mit sich bringen können.
Aus unserer Perspektive können wir zu diesem Sachverhalt teilen, dass auch der Anteil von angebotenen Medikamenten in Fake-Shops (häufig über niederländische Domains) immer weiter steigt. Ob Ware als Produktpiraterie versendet oder gar nicht erst ein Paket losgeschickt wird, lässt sich in der puren Masse an Shops nicht mehr prüfen. Ebenfalls sollen nicht nur die direkten wirtschaftlichen Folgen durch Produktpiraterie betrachtet werden, sondern auch reduziertes Vertrauen von Konsumentinnen und Konsumenten, wie in diesem Blog beschrieben.
Die Masche mit den Fake-Accounts
Produktpiraterie und Markenrechtsverletzungen werden heute gezielt über soziale Netzwerke wie Instagram, TikTok und YouTube betrieben. Nach der Produktion der Fälschungen nutzen die Täter verschiedene Strategien, um ihre Produkte an den Kunden zu bringen:
Eigene Fake-Accounts: Häufig werden eigene Social-Media-Accounts mit eigenem Namen und Design erstellt, um gefälschte Produkte zu bewerben.
Kopieren des Markenauftritts: Besonders perfide ist das exakte Kopieren des offiziellen Markenauftritts, inklusive Name, Logo und Bildsprache. Das erschwert es Konsumenten, echte von gefälschten Angeboten zu unterscheiden.
Gezielte Werbeanzeigen: Der Vertrieb erfolgt oft über gezielte Anzeigen und Produktplatzierungen, die direkt auf die Zielgruppe zugeschnitten sind.
Einsatz von Influencern: Influencer bewerben – oft gegen Provision – offen oder verdeckt gefälschte Produkte. Sie präsentieren die Fakes in Videos oder Posts und verlinken auf die Verkaufsseiten. Dadurch erhalten sie Provisionen für jede vermittelte Bestellung.
Tipp: In zwei weiteren Anleitungen zeigen wir Ihnen, wie Sie Fake Accounts bei Instagram und bei YouTube melden können.
Wie Fake-Shops Verbraucher täuschen
Die Grenze zwischen Produktpiraterie (also gefälschten Produkten) und reinen Fake-Shops (wo die Konsumenten keine Ware erhalten) ist sehr eng miteinander verbunden. Daher skizzieren wir hier nochmals die typischen Strategien bei Fake-Shops in diesem Zusammenhang:
Kopierte Designs: Fake-Shops kopieren das Design bekannter Online-Shops und ändern nur geringfügig die Domain (zum Beispiel .net statt .de) oder bauen kleine Rechtschreibfehler im Markennamen ein.
Gefälschte Bewertungen: Positive Bewertungen werden gekauft oder erstellt, um Vertrauen zu schaffen.
Professionelle Aufmachung: Gütezeichen werden als Bilder eingebunden, ohne korrekte Verlinkung zu den Gütesiegel-Websites.
Fehlende Impressen: Viele Fake-Shops haben kein ordnungsgemäßes Impressum oder verwenden gestohlene Firmendaten.
Viele weitere Faktoren: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz macht es Betrügern immer leichter, echte Online-Shops eins zu eins zu kopieren und Markenrechtsverletzungen zu begehen. Daher ist die Erkennung eines Fake-Shops vermehrt als ein Zusammenspiel vieler Faktoren zu sehen. Mehr dazu finden Sie in diesem Blog.
Warnsignale für Fake-Bewertungen
Egal, ob wir von Produktpiraterie oder Fake-Shops sprechen: Verbraucherinnen und Verbraucher sollen mittels guter Bewertungen zum Kauf überzeugt werden. Dabei können folgende Punkte ein Warnsignal sein:
Außergewöhnlich viele Bewertungen für neue Produkte. Dies kann einerseits dafür sprechen, dass Bewertungen massenhaft erstellt wurden, oder dass neue Produkte …
Übertriebene Formulierungen mit Werbesprache und Superlativen
Sehr lange Rezensionen kurz nach Produktveröffentlichung
Schlechte Grammatik, die auf ausländische Dienstleister oder KI-Programme hindeutet
Kaum natürliche Bilder zu den Produkten. Sind bei vielen Bewertungen nur sehr wenige echte Bilder vorhanden oder die Bilder sehen KI-generiert aus, ist Vorsicht geboten.
Aber Achtung: Wie immer gilt, dass es ein Zusammenspiel vieler Faktoren ist. Die Betreiber von unautorisierten Online-Shops sind ebenfalls auf diese Signale aufmerksam geworden und bauen verstärkt auch 4-Sterne-Bewertungen in die Rezensionen ein und stellen vermeintlich kritische Fragen.
Betroffene Branchen und Produkte
Das Spektrum der Plagiate hat sich deutlich erweitert. Schlichtweg gibt es kaum eine Branche, die nicht betroffen ist. Eines der großen Irrtümer bei der Produktpiraterie ist, dass lediglich große oder bekannte Marken betroffen sind. Dennoch sind folgende Produkte und Branchen besonders beliebt bei Fälschern:
Elektroartikel und Medizinprodukte
Maschinen und ganze Industrieanlagen
Kosmetika und Kinderspielzeug
Medikamente und lebenswichtige Arzneimittel (besonders starke Zuwächse in Österreich zwischen 2022 & 2023)
Sicherheitsprodukte wie Feuermelder
Welche Beispiele gibt es für Produktpiraterie?
Mit diesen fünf Beispielen wird das gesamte potenzielle Ausmaß von Produktpiraterie deutlich:
LEGO gegen Lepin (China):
Nachdem die LEGO Gruppe feststellte, dass nahezu identische „Lepin“-Sets globale E-Commerce-Seiten überschwemmten, reichte sie ab 2016 18 Klagen wegen Urheberrechtsverletzung und unlauteren Wettbewerbs in Guangzhou ein. Chinesische Gerichte erteilten weitreichende Unterlassungsanordnungen und sprachen LEGO 4,7 Millionen ¥ Schadensersatz zu, wobei LEGO-Verpackungen und Mini-Figuren als schützenswerte Kunstwerke anerkannt wurden. Parallele Polizeirazzien im Jahr 2019 beschlagnahmten gefälschte Steine im Wert von 300 Millionen ¥; der Rädelsführer erhielt eine 6-jährige Haftstrafe und eine Geldstrafe von 90 Millionen ¥, wobei acht Komplizen für bis zu 4,5 Jahre inhaftiert wurden. Im Jahr 2020 bestätigte das Shanghaier Oberste Volksgericht diese Strafurteile, was ein härteres Vorgehen gegen IP-Verletzungen in China signalisierte und LEGOs beharrliche, mehrgleisige Durchsetzungsstrategie bestätigte.
Nike gegen Warren Lotas (USA):
Der Streetwear-Designer Warren Lotas begann, „neu interpretierte“ SB Dunk-Sneaker zu verkaufen, die Nikes Silhouette kopierten und sogar auf die berühmte „Pigeon“-Farbgebung anspielten. Nike reichte im Oktober 2020 Klage vor dem Central District of California wegen Marken- und Aufmachungsverletzung ein und betonte die Verwechslungsgefahr auf dem Markt und die Verwässerung des „Swoosh“-Logos. Eine einstweilige Verfügung stoppte die Lieferungen vor der Veröffentlichung. Im Dezember 2020 teilten beide Parteien dem Gericht eine vertrauliche Einigung mit: Lotas stimmte einem Zustimmungsurteil und einer dauerhaften Unterlassungsanordnung zu, die jegliche Schuhe verbietet, die Nikes geschützten Dunk-Designelementen „verwechslungsähnlich“ sind. Nikes schnelle Klage und die Bereitschaft zur öffentlichen Einigung unterstrichen die Null-Toleranz-Haltung und vermieden gleichzeitig einen langwierigen Prozess.
Crocs gegen USA Dawgs & Double Diamond (Kanada/USA):
Seit 2006 streitet Crocs mit Dawgs über Schaumstoff-Clogs, die angeblich sein patentiertes Design nachahmen. Frühe kanadische Klagen konzentrierten sich auf falsche Werbeaussagen, aber Crocs eskalierte, indem es zweimal – zuerst 2006 und erneut 2021 – die U.S. International Trade Commission (ITC) beantragte, um die Einfuhr von Nachahmungen zu blockieren. In parallelen Bundesprozessen sprach ein Urteil von 2022 Crocs 6 Millionen US$ von USA Dawgs und 55.000 CA$ von Double Diamond zu, wobei beide Beklagten die Gültigkeit der Patente einräumten. Die allgemeine Ausschlussanordnung der ITC verbietet nun die Einfuhr jeglicher nicht autorisierter Crocs-ähnlicher Schuhe in die Vereinigten Staaten, was zeigt, wie Handelsrechtshilfen zivilrechtlichen Schadensersatz in grenzüberschreitenden Pirateriefällen ergänzen können.
Louis Vuitton gegen eBay (Frankreich):
Der Luxuskonzern LVMH verklagte eBay vor dem Pariser Handelsgericht, weil dieser den Verkauf gefälschter Louis Vuitton- und Dior-Waren auf seinem Marktplatz zugelassen hatte. Im Jahr 2008 befand das Gericht eBay für haftbar als mehr als nur einen passiven Host, verhängte 38,5 Millionen € Schadensersatz und ordnete die Veröffentlichung des Urteils an. eBay legte Berufung ein und argumentierte, es habe das VeRO-Takedown-Programm implementiert; 2010 reduzierte das Berufungsgericht die Strafe auf 5,7 Millionen €, bestätigte jedoch eBays Verpflichtung, Angebote zu überwachen und selektive Vertriebssysteme für LVMH-Parfums einzuhalten. Der Fall schuf einen Präzedenzfall auf dem Kontinent, dass Plattformen direkt haftbar gemacht werden können, wenn sie bei bekannten Fälschungen nicht handeln, was eBay dazu veranlasste, Authentifizierungs- und Markenschutz-Tools zu stärken.
Christian Louboutin gegen YSL (USA)
Der Schuhdesigner Christian Louboutin verklagte Yves Saint Laurent im Jahr 2011 und behauptete, YSLs monochrome rote Pumps verletzten seine US-Marke für eine lackierte rote Außensohle. Das Bezirksgericht zweifelte zunächst daran, dass eine einzelne Farbe als Modemarke dienen könnte, aber im Berufungsverfahren hob der Second Circuit teilweise auf und bestätigte die Gültigkeit von Louboutins Marke, wenn die rote Sohle mit dem Obermaterial kontrastiert, während er die Klage für YSLs ganz rote Schuhe abwies. Das nuancierte Urteil zwang Louboutin, den Umfang seiner Registrierungen zu präzisieren, bewahrte aber seinen Markenwert für die ikonische kontrastierende rote Sohle. YSL verkaufte derweil weiterhin monochrome Versionen, was zeigt, wie gerichtlich gezogene Grenzen ein Nebeneinander ohne vollständige Unterlassungsansprüche ermöglichen können.
Gesundheits- und Sicherheitsrisiken
Wie man sich leicht vorstellen kann, stellen gefälschte Produkte erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken dar. Die Fälscher verwenden minderwertige oder gesundheitsschädliche Materialien und halten sich meistens weder an Sicherheitsstandards noch an vorgegebene Grenzwerte.
Konkrete Gefahren umfassen:
Medikamente: Gefälschte Arzneimittel enthalten oft gar keinen Wirkstoff oder den falschen, mit teils lebensbedrohlichen Folgen wie Unterzuckerung oder Nierenversagen.
Elektronik: 99 Prozent aller gefälschten Adapter sind gefährlich und können zu Kabelbränden und Stromschlägen führen.
Kosmetika: 35 Prozent aller gefährlichen Fälschungen in Europa sind Kosmetikartikel, die verbotene Wirkstoffe enthalten und zu Hautirritationen führen können.
Sicherheitsprodukte: Gefälschte Sonnenbrillen haben oft keinen UV-Schutz, defekte Feuermelder können im Ernstfall nicht anspringen und Lebensgefahr bedeuten.
Markenschutz: Ihr Bollwerk gegen Betrug
Ein starker Markenschutz ist entscheidend, um Produkte, Ruf und Investitionen vor Nachahmung und den daraus resultierenden finanziellen Verlusten zu schützen. Geistiges Eigentum, das nicht als Schutzrecht bei den Patent- und Markenämtern angemeldet ist, kann weniger effektiv verteidigt werden.
Rechtliche Schutzinstrumente
Das deutsche Rechtssystem bietet verschiedene Schutzrechte für geistiges Eigentum:
Markenrecht: Schutz von Namen, Logos und Kennzeichen
Patentrecht: Schutz technischer Erfindungen und Verfahren
Designrecht: Schutz der äußeren Form- und Farbgestaltung
Urheberrecht: Automatischer Schutz kreativer Schöpfungen
Strafrechtliche Konsequenzen
Marken- und Produktpiraterie werden als Wirtschaftskriminalität in Deutschland eingestuft und sind mit empfindlichen Strafen verbunden. In Fällen von gewerblicher Markenpiraterie können Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren verhängt werden. Im Jahr 2024 wurden rund 11.300 Straftaten in diesem Zusammenhang mit Urheberrechtsbestimmungen polizeilich erfasst.
Ein zentrales Problem bleibt jedoch immer noch der internationale Handel: Innerhalb der EU können Unternehmen Antrag auf Grenzmaßnahmen stellen. In diesem Fall werden Markeninhaber bei Funden im Zoll informiert und haben eine 10-tägige Frist zur Bestätigung der Rechtsverletzung. Diese Maßnahme wirkt jedoch nur dann, wenn auch Produkte gefunden werden. Hier ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass die EU nur den eigenen Import kontrollieren und ggf. sanktionieren kann. In anderen Regionen gibt es für die regionalen Märkte wieder andere Maßnahmen.
Sollten die gefälschten Produkte bereits im Markt sein, können sofortige Verkaufsstopps in Online-Shops, auf Plattformen, in Läden und allen weiteren Kauforten erzwungen werden. Auch können gegen Tochterunternehmen innerhalb der EU einstweilige Verfügungen gestellt werden.
Für den internationalen Handel hat die EU Abkommen beispielsweise mit China beschlossen, die Rechtsverletzungen verhindern und den Markenschutz ausbauen sollen. Wie groß die Wirkung dieser Maßnahme ist, lässt sich jedoch bestreiten.
Fest steht, dass all diese Maßnahmen nicht einige Hersteller abhalten, Produktpiraterie zu betreiben. Unternehmen können im Sinne des Markenschutzes neben den Anmeldungen (Marken, Patente, Design und Urheberrecht) auch technische Wege wählen, um sich zusätzlich abzusichern.
Technische Schutzmaßnahmen
Folgende Auswahl wird immer häufiger in Produkte integriert:
Hologramme und Sicherheitsetiketten
Spezialtinten und Magnetstreifen
Microtaggants und Smartcards
Lasergravur und Wasserzeichen
Online-Monitoring zum Markenschutz
Neben den staatlichen Maßnahmen (wie Beschlagnahmungen beim Zoll) und technischen Produktintegrationen (wie Chips) lohnt es sich für Marken und Händler, ein Online-Monitoring zum Markenschutz einzusetzen. Die Systeme durchsuchen weltweit Plattformen, soziale Netzwerke und Websites nach unautorisierten Produkten & Händlern.
Über Kooperationsverträge mit den Betreibern übernehmen Systeme wie Context Verify die schnelle Meldung und Abwicklung der Funde. Zentrales Ziel: Marken können sich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Mehr dazu finden Sie hier.
Unser Fazit
Produktpiraterie ist weit mehr als nur eine billige Fälschung – sie bedroht Arbeitsplätze, Innovationen und die Gesundheit der Verbraucher. Mit jährlichen Schäden von Milliarden Euro und dem Verlust hunderttausender Arbeitsplätze ist sie zu einer ernsten Bedrohung für die europäische Wirtschaft geworden.
Nur durch eine Kombination aus starkem rechtlichen Schutz, technischen Sicherheitsmaßnahmen und konsequenter Strafverfolgung kann diesem Problem wirksam begegnet werden. Dabei sind sowohl Unternehmen als auch Verbraucher gefordert: Unternehmen müssen ihre Schutzrechte sichern und Verbraucher müssen für die Gefahren von Fake-Produkten sensibilisiert werden.
Markenschutz
Ihr Schutz vor Marken-imitationen
Lassen Sie Fake Shops & Domains automatisiert erkenen, analysieren und entfernen.